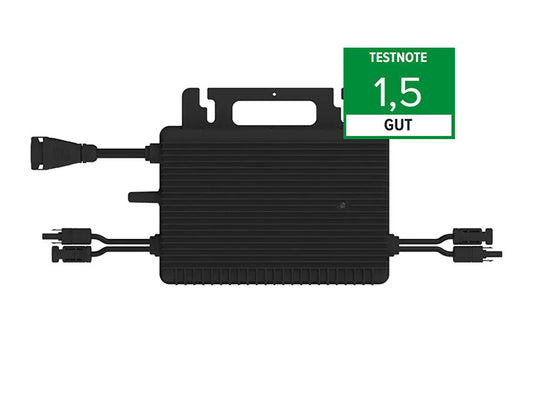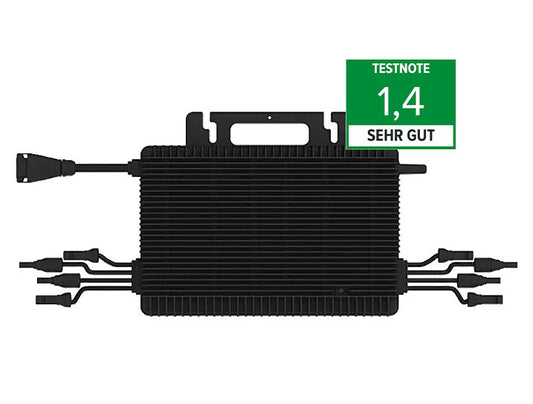Steckerfertige Solaranlagen und Balkonkraftwerke zählen seit Mitte 2024 zu den privilegierten Maßnahmen: Anders als zuvor kann Ihnen der Netzbetreiber noch eine solche Anlage nicht mehr verbieten oder durch Auflagen erschweren. Bis zu 800 Watt Einspeiseleistung sind erlaubt, dafür maßgeblich ist allein die Nennleistung des Wechselrichters. Sie ist auf dem Gerät oder den Begleitpapieren vermerkt. Einen stärkeren Wechselrichter mit z.B. 1600 oder 2000 Watt zu verwenden und durch Softwareeingriffe auf 800 Watt zu begrenzen, ist nicht erlaubt.

Mehr Solarmodule – Overpaneling bis zu 2000 Watt macht sich bezahlt
Erlaubt hingegen ist es, in der Gesamtleistung Solarmodule von bis zu 2000 Watt an einem Wechselrichter zu betreiben. Wie bereits erwähnt, muss der Wechselrichter vor der Abgabe ins Hausnetz rechtskonform auf maximal 800 Watt Einspeiseleistung herunterregeln. Darüber hinaus verpufft der erzeugte Strom.
Dieses Overpaneling, also mehr und leistungsstärkere Solarmodule am Wechselrichter anzuschließen, ergibt dennoch Sinn. So wird auch in der kälteren und dunkleren Jahreszeit, bei schlechterem Wetter oder wenig Sonnenlicht frühmorgens oder am Abend insgesamt mehr Strom erzeugt.
Leistet zum Beispiel ein Solarmodul bei schlechten Bedingungen statt 400 Watt nur noch 50 Watt, so könnten 4 Solarmodule an selber Stelle immerhin 200 Watt erzeugen. Je nach Haushaltsgröße kann das die halbe Grundlast abdecken. Bei guten Bedingungen wiederum werden die maximal erlaubten 800 Watt viel häufiger und durchgehend eingespeist. Dann läuft die gesamte Anlage am optimalen Punkt.
Dennoch sollte, wer die Wahl und Möglichkeit hat, nicht alles auf eine Karte setzen: 4 Solarmodule nach Süden werden im Sommer fast immer in der Leistungsabgabe begrenzt, mitunter halbiert sein. Je 2 Solarmodule nach Osten und nach Westen oder eine Ost-Süd-West-Aufstellung verteilen den Stromertrag sinnvoller über den Tag. Dafür muss man aber natürlich die entsprechenden Voraussetzungen haben. Auch bei nicht so optimaler Aufstellung und Ausrichtung kann sich ein Balkonkraftwerk aber ebenfalls lohnen.
Balkonkraftwerk und Mietwohnung – was ist zu beachten?
Auch viele Mieter haben Balkone und ein Interesse daran, ihre Stromkosten zu senken. Die Frage, die sich dann stellt: Muss der Vermieter das Balkonkraftwerk genehmigen? Nein, der Vermieter muss auch nicht gefragt werden. Wir empfehlen aber, ihn zu informieren. Denn als Eigentümer hat der Vermieter naturgemäß ein Interesse an der Außenansicht seiner Immobilie. Er kann zum Beispiel Vorgaben machen, welche Modulästhetik verwendet wird und wie die Module anzubringen sind (zum Beispiel nur horizontal statt vertikal).
Leider versäumen es bisher viele Vermieter und Hausverwaltungen, aktiv auf Ihre Mieter zuzugehen und Angebote für einheitliche Balkonkraftwerke vorzulegen. Der gemeinsame Einkauf für mehrere Mietparteien würde auch Kostenvorteile bringen.
Beachten müssen Wohnungsmieter in jedem Fall, dass sie das Balkonkraftwerk beim Marktstammdatenregister anmelden müssen. Bei einem Umzug können Mieter ihr Balkonkraftwerk selbstverständlich mitnehmen oder wie jede andere Einrichtung dem Nachmieter überlassen.
Stromzähler rückwärts laufen lassen – darf man das?
Wir sind alle rechtschaffene Bürgerinnen und Bürger, weshalb diese Frage natürlich rein theoretischer Natur ist und schnell abgehandelt werden kann.
Wobei, nehmen wir uns doch die Zeit: Technisch möglich ist der Rückwärtslauf nur bei einem alten, analogen Stromzähler, wie er noch in hunderttausenden, vielleicht Millionen deutschen Familien- und Wohnhäusern installiert ist: dem sogenannten Ferraris-Zähler. Und auch nur, wenn ihm nicht (nachträglich) eine mechanische Sperre eingebaut wurde.
Der Ferraris-Zähler stammt aus dem 19. Jahrhundert und somit aus einer Zeit, in der an Stromerzeugung für Jedermann noch gar nicht zu denken war. Ebendieses gut gepflegte Relikt dreht tatsächlich rückwärts, wenn elektrische Energie eingespeist wird. Im Ergebnis bedeutet das: Wenn Sie eine Kilowattstunde Strom von Ihrem Stromanbieter kaufen, läuft der Ferraris-Zähler in seiner Anzeige eine Kilowattstunde vor. Wenn Sie eine Kilowattstunde Strom erzeugen und nicht verbrauchen, also ins öffentliche Stromnetz einspeisen, damit andere sie nutzen können, läuft der Ferraris-Zähler wieder eine Kilowattstunde zurück. Sie hätten damit die zuvor gekaufte Kilowattstunde Strom wieder "reingeholt" und nichts zu bezahlen. Quid pro quo, sozusagen.
Klingt charmant, irgendwie genossenschaftlich und die Niederländer zum Beispiel machen das auch so. Dort rentiert sich eine Solaranlage sofort mit jeder erzeugten Kilowattstunde, ganz ohne Einspeisevergütung oder Umweg über teuren Batteriespeicher.
In Deutschland ist der rückwärtslaufende Stromzähler verboten. Das kam auch nicht erst mit der Nachfrage nach Balkonkraftwerken. Die kleinen Solaranlagen mit Schuko-Stecker müssen angemeldet werden (im Marktstammdatenregister) und der Netzbetreiber darf darauf bestehen, nach Bekanntwerden einen modernen Stromzähler einzubauen. Dafür muss er fairerweise die Kosten tragen und in der Zeit zwischen Anmeldung und Zählerwechsel darf der alte Stromzähler tatsächlich legal rückwärts laufen.
Offiziell geht man davon aus, dass bisher 37% der Stecker-Solaranlagen in Deutschland offiziell angemeldet wurden. Vorschub für mehr Anmeldungen leisteten sicherlich vielerlei Förderprogramme, die ein Balkonkraftwerk mit 300 Euro, 500 Euro oder noch mehr subventionierten, mittlerweile aber häufig ausgeschöpft sind.
Rechnet man über die Verkaufszahlen von Mikro-Wechselrichtern hoch, wären sogar nur knapp 25% der Balkon- und Gartenkraftwerke ordnungsgemäß registriert. Gemunkelt wird von (deutlich) weniger.
Bis 2032 sollen auch die letzten Ferraris-Zähler ausgetauscht werden. Liese sich in den Jahren bis dahin durch einen rückwärts laufenden Ferraris-Zähler vielleicht sogar mehr einsparen, als selbst das beste Förderprogramm hergibt? Einkalkulieren sollte man dabei in jedem Fall die Strafen, die verhängt werden können: 1 Euro pro 100 Watt Anlagenleistung und Monat. Bei einer Anlage mit 800 Watt also 8 Euro pro Monat oder 96 Euro pro Jahr, auch rückwirkend.