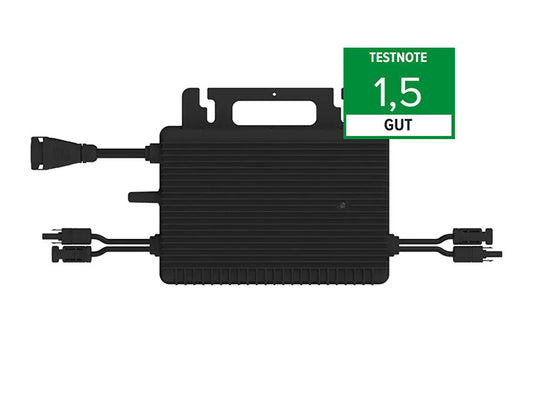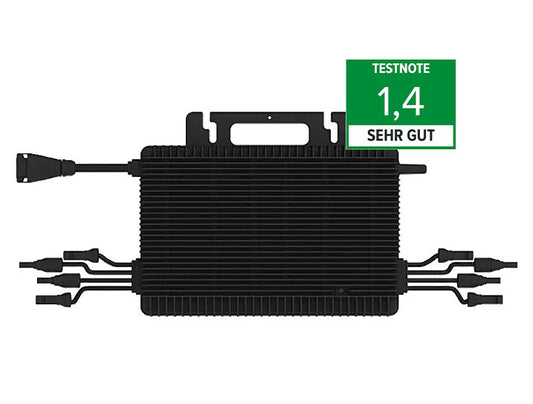Der Anfang mit einem Balkonkraftwerk ist schnell gemacht: Die Solarmodule an den Wechselrichter anstecken, den Wechselrichter an die Steckdose – fertig. Ein Balkonkraftwerk ohne Speicher lohnt sich schnell und weder bei Solarmodulen noch bei Wechselrichtern sind in den nächsten Jahren große technologische Sprünge zu erwarten, die sich bei den üblichen Anlagen mit 2 bis 4 Solarmodulen spürbar auswirken würden. Die heutigen Angebote sind leistungsstark und preislich kaum zu unterbieten.
Anders ist es bei Stromspeichern: Die Akkutechnologien allgemein verbessern sich von Jahr zu Jahr enorm oder werden immer günstiger. Hier lohnt es sich, mit der Anschaffung noch zu warten und erst einmal ohne Speicher anzufangen und Erfahrung zu sammeln.
Wer dennoch schon einen Stromspeicher für sein Balkonkraftwerk anschaffen oder nachrüsten möchte, für den stellt sich die Frage: Wie sieht es rechtlich aus?
Anmeldung und rechtliche Situation
Balkonkraftwerke können heute unkompliziert im Marktstammdatenregister angemeldet werden. Auch ein Stromspeicher kann angemeldet werden, aber zu beachten ist: Ein Steckersolargerät ist per Definition im Erneuerbare Energien Gesetz EEG eine Kombination aus Solarmodulen, Wechselrichter, Anschlussleitung und Stecker – ein Speicher wird nicht erwähnt. Deshalb gelten die vereinfachten Anmelde- und Betriebsregeln für Balkonkraftwerke derzeit nicht automatisch auch für Speicher. In manchen Fällen verlangen Netzbetreiber sogar den Anschluss durch einen Elektriker und die gesonderte Fachbetriebsanmeldung, wenn bei der Anmeldung des Balkonkraftwerks auch ein Stromspeicher angemeldet wird.
Ziel laufender politischer und verbandsseitiger Initiativen ist es, Speicher rechtlich gleichzustellen und Bürokratie abzubauen. Langfristig sollen Balkonkraftwerk und Speicher als ein zusammengehöriges System gelten. Das ist jetzt 2025 aber noch nicht so.
Eigentum, Versicherung und Förderung
Im Wohneigentum gibt es keine Einschränkungen für den Einsatz eines Stromspeichers. Auch Vermieter oder Eigentümergemeinschaften dürfen den Einsatz eines Steckerspeichers in der Regel nicht untersagen, solange dieser das äußere Erscheinungsbild eines Gebäudes nicht verändert (also von außen nicht zu sehen ist). Eine Genehmigungspflicht besteht also nicht.
Auch gegenüber Versicherungen ist kein spezieller Eintrag erforderlich. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte bei der Hausrat- oder Haftpflichtversicherung aber nachfragen, ob der Speicher mitversichert ist.
Förderungen für Stromspeicher entwickeln sich bereits positiv: Einige Städte und Bundesländer wie Berlin haben bereits Programme, die Speicher im Rahmen von Balkonkraftwerken mitfördern. Selbst ein Betrieb mit EEG-Vergütung ist grundsätzlich möglich, wird aber aktuell selten genutzt und ist den bürokratischen Aufwand wohl auch nicht wert.
Normung und europäische Entwicklung
Die technische Normung von Steckerspeichern steckt noch in den Anfängen. Der VDE hat eine Produktnorm für Steckersolargeräte veröffentlicht, Speicher aber bewusst ausgeklammert. Nun arbeitet ein eigener Arbeitskreis an einer separaten Speicher-Norm, unterstützt von Forschungsprojekten und Herstellern.
Auch auf EU-Ebene bewegt sich etwas: Die neue Elektrizitätsmarktrichtlinie (2024/1711) empfiehlt, Hürden für Kleinstsolaranlagen abzubauen und flexible Netzentgelte zu ermöglichen. Gleichzeitig versuchen internationale Normengremien, die Einspeisung über Standardstecker zu begrenzen, was auch Speicher betreffen könnte. Deutschland will hier eigene, praxisnahe Lösungen entwickeln.
Fazit: Die rechtlichen Grundlagen für Stromspeicher bei Balkonkraftwerken sind noch im Aufbau, doch die Richtung ist klar: mehr Vereinfachung, mehr Freiheit, weniger Bürokratie.
Technisch sind Speicher für Balkonkraftwerke noch nicht so ausgereizt wie Solarmodule und Wechselrichter. Es ist also kein Problem, bei Steckerspeichern auf neue Technologieentwicklungen und Preissenkungen zu warten.